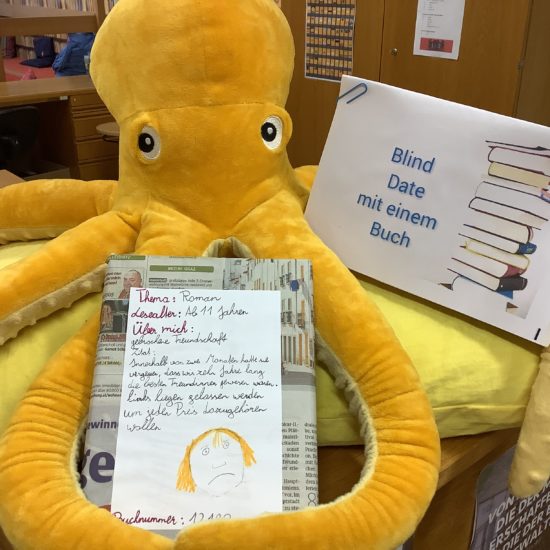Erfolg bei der Philosophieolympiade
Thema 2:
„Schon eine vollkommen sichere, unzweideutige Verständigung der Menschen untereinander ist unmöglich, ist ein Ziel, dem wir uns immer mehr nähern, das wir aber nie erreichen können. Schon aus diesem Grund ist exakte Wissenschaft nie wirklich möglich.“ (Erwin Schrödinger: Meine Weltansicht. 1961, S. 139)
Die große Frage nach dem WAS und WARUM: Warum ist menschliche Verständigung so wie sie ist? Was ist Wissenschaft? Warum braucht es Wissenschaft? Warum spielt die Verständigung in der Wissenschaft eine so große Rolle?
Die menschliche Sprache hat sich im Laufe der Evolution entwickelt, um die Zusammenarbeit und das Überleben in Gruppen zu ermöglichen. Dabei war Perfektion nie das Ziel. Stattdessen hat sich Sprache als ein flexibles Werkzeug entwickelt, das für soziale Interaktionen wichtig ist. Das Gehirn verarbeitet Sprache, indem es Informationen filtert, abstrahiert und interpretiert – eine Methode fernab von „perfekt“. Stellt sich die Frage, ob diese Interpretationen immer einen Nachteil darstellten. Eventuell waren diese sogar der Schlüssel zu weitaus kreativeren Lösungen. Lösungen, die die Menschheit sonst nie in Betracht gezogen hätte. Missverständnisse gelten oft als Hindernisse in der Kommunikation, doch sie können auch der Ursprung von Kreativität sein. In der Geschichte der Menschheit haben Missverständnisse nicht selten dazu geführt, dass neue Perspektiven und Ideen entstanden sind. Auch in der Wissenschaft spielen Missverständnisse eine essenzielle Rolle. Irrtum und fehlerhafte Hypothesen zwingen Forscher:innen, ihre Annahmen zu überdenken und kreative Lösungsansätze zu entwickeln. Die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus ist ein Beispiel dafür, wie ein Missverständnis – die falsche Annahme, eine direkte Route nach Indien gefunden zu haben – ungeahnte Konsequenzen und neue Möglichkeiten eröffnete. Die Unvollkommenheit unserer Sprache und Verständigung ist daher nicht nur ein Hindernis, sondern auch fortschrittsvorantreibend.
Die Entwicklung der Sprache zeigt, wie eng Kommunikation mit dem menschlichen Fortschritt und so auch mit dem Streben der Menschen nach Wissen verbunden ist. Höhlenmalereien – Lauten & Gesten – Schriften – mathematische Symbole – Programmiersprachen – …
Schrift ermöglichte Verständigung. Nicht nur im Alltag, sondern auch in der Wissenschaft. Sie ermöglichte, dass Wissen über Generationen hinweg bewahrt, weitergegeben und erweitert werden konnte. Doch stellt sich dabei eine entscheidende Frage: Kann Sprache die Realität wirklich darstellen? Die Realität, die für die Wissenschaft so wichtig ist. Konzentrieren wir uns zuerst auf die Definition von Wissenschaft:
„Wissenschaft bezeichnet somit ein zusammenhängendes System von Aussagen, Theorien und Verfahrensweisen, das strengen Prüfungen der Geltung unterzogen wurde und mit dem Anspruch objektiver, überpersönlicher Gültigkeit verbunden ist.“
Oder aber:
„Die Wissenschaft ist ein System der Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften, kausalen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der Natur, Technik, Gesellschaft und des Denkens, das in Form von Begriffen, Kategorien, Maßbestimmungen, Gesetzen, Theorien und Hypothesen fixiert wird.“
Wissenschaft strebt also danach, objektive Wahrheiten zu finden, die über die menschliche Subjektivität hinausgehen. Wie? Durch immer und immer wiederholte Experimente, klare Definitionen und präzise Formulierungen. Und hier stehen wir wieder am Punkt, der alles verkompliziert. Definitionen sind menschengemacht. Formulierungen sind menschengemacht. Wissenschaft ist menschengemacht. Sprache kann so präzise sein, und doch immer noch Interpretationsspielraum lassen. Und so bleibt eine Frage offen: Wie soll man mit der unperfekten Sprache das Perfekte der Realität darstellen?
Jedes Wort und jeder Satz, den eine Person spricht, wird von ihr beeinflusst. Wenn ich eine Aussage tätige, ist das nichts anderes, als meine Perspektive, mein Zugang zu einem Thema. Dieser Zugang kommt aber auch nicht von ungefähr. Er wird geprägt von meinen Erfahrungen, meinem kulturellen Hintergrund, meiner Familie, meinen Lehrer:innen, meinen Mitschüler:innen, meinen Freunden, meiner Erziehung, der Sprache, die ich spreche, der Literatur, die ich lese und den Medien, die ich konsumiere. Unsere Wahrnehmung der Welt ist immer subjektiv, wir alle sehen Farben in unterschiedlichsten Farbtönen. Das Beispiel: Indigoblau, Cyanblau, Azurblau, Saphirblau, Türkisblau. Was ist der Unterschied zwischen den Farben? Wir alle haben nun unterschiedlichste Auffassungen dieser Farben und keine dieser Auffassung entspricht einer anderen.
Schrödinger spricht von der Unmöglichkeit einer vollkommen sicheren und unzweideutigen Verständigung. Sieht man sich den Bereich der Übersetzungen an, erkennt man dass die Übersetzung einem Prozess gleicht. Einem Prozess der Interpretation, bei dem Bedeutungen der Ausgangssprache in eine andere Sprache übertragen werden. Bedeutungsverluste inklusive. Jede Übersetzung ist abhängig von der kulturellen Perspektive des Übersetzers. Kulturelle Unterschiede können dazu führen, dass Übersetzungen in verschiedenen Kontexten unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert werden. Was in einer Sprache als selbstverständlich gilt, mag in einer anderen Sprache und Kultur ganz anders verstanden oder sogar als problematisch empfunden werden.
Die Problematik der Übersetzung lässt sich ebenfalls auf die Medien übertragen. Die Art und Weise, wie Informationen durch Medien verbreitet werden, ist immer durch die Perspektiven und Interpretationen derjenigen gefiltert, die sie präsentieren. In den Nachrichten wird ein Ereignis nie „objektiv“ wiedergegeben. Jede Nachricht durchläuft einen Filter, der durch kulturelle, gesellschaftliche oder politische Einflüsse geprägt ist. Ob bewusst oder unbewusst sei hier nun mal dahingestellt. Unser Zugang zur „Wirklichkeit“ bleibt durch Medien immer subjektiv. Das Bild, das wir von der Welt erhalten, ist nie vollkommen objektiv, sondern stets eine Konstruktion – beeinflusst von denjenigen, die die Informationen liefern.
Es ist auch wichtig, dass sich Sprache selbst verändert, genauso wie die Welt es tut. Neue Begriffe werden geschaffen, alte Bedeutungen verändert oder ersetzt. Was heute als objektiv und klar gilt, könnte morgen schon hinterfragt werden. Das bedeutet, dass unsere wissenschaftlichen Theorien nicht nur von der Zeit und dem Kontext beeinflusst werden, in dem sie entstehen, sondern auch von der Sprache, die wir verwenden, um sie auszudrücken. Das gilt auch für die Wissenschaft. Wissenschaftliche Begriffe und Theorien entstehen nicht aus dem Nichts, sondern finden ihren Ursprung in einer spezifischen Zeit, Kultur und Sprache.
In diesem Zusammenhang kann es helfen, die Aussage von Ludwig Wittgenstein zu betrachten:
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“
Dieser Gedanke verdeutlicht die enge Verknüpfung zwischen Verständigung und Weltanschauung. Unsere Fähigkeit, die Welt zu verstehen und zu kommunizieren, ist mit den Grenzen unserer sprachlichen Ausdruckskraft verbunden. Das bedeutet, dass auch unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse immer so stattfinden, dass man dies mit der verfügbaren Sprache und den dazugehörigen Begriffen sagen kann. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug der Verständigung ist, sondern auch ein Werkzeug zum Ordnen der Welt – nach unserer eigenen Perspektive, versteht sich.
Ein weiteres zentrales Thema in Bezug auf Schrödingers Zitat ist die Frage, wie Wissen innerhalb der Wissenschaft konstruiert wird. Wenn wir über Wissenschaft nachdenken, denken wir oft an objektive Entdeckungen, die unabhängig von individuellen Wahrnehmungen und kulturellen Einflüssen existieren. Doch in Wahrheit sind wissenschaftliche Theorien einfach „nur“ Modelle. Sie sind keine absoluten Wahrheiten, sondern zeitgebundene Versuche, die Realität zu beschreiben und zu erklären. Diese Modelle dienen als Brillen, durch die wir die Welt betrachten, und sie sind immer unvollständig. Ein Beispiel hierfür ist die Newtonsche Physik. Über Jahrhunderte hinweg galt Newtons Gesetz der Gravitation als eine exakte Beschreibung der Kräfte, die Körper im Universum miteinander verbinden. Doch als Albert Einstein seine Relativitätstheorie formulierte, zeigte sich, dass die klassische Physik nur eine Annäherung an die Realität war. Die Newtonsche Gravitationstheorie ist immer noch nützlich und funktioniert in vielen praktischen Fällen, aber sie erklärt nicht alles. Sie ist schlichtweg unvollständig. Diese Entwicklung zeigt, dass wissenschaftliche Theorien keine endgültigen Wahrheiten sind. Sie sind Modelle, die sich verändern und überarbeitet und verfeinert werden – wenn neue Daten und Erkenntnisse auftauchen. Wissenschaft ist daher nicht das Streben nach einer objektiven, endgültigen Wahrheit, sondern ein Prozess. Modelle werden immer und immer wieder an die Grenzen der neusten Erkenntnisse angepasst. Und das macht es so schwierig, ein „perfektes“ Wissen in der Wissenschaft zu erreichen. Wissenschaftliche Entdeckung kann man also nicht von Kommunikation trennen. Selbst wenn Experimente unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt werden, ist die Art und Weise, wie wir diese Experimente beschreiben und die Daten analysieren, immer von der Sprache und den Begriffen abhängig, die uns zur Verfügung stehen.
Das führt uns zurück zu Schrödingers Zitat: Die Schwierigkeit, eine „vollkommen sichere, unzweideutige Verständigung“ zu erreichen, betrifft nicht nur den Alltag, sondern auch die Wissenschaft. Schrödinger meint, dass selbst die präziseste Sprache und die klarsten Definitionen nicht verhindern können, dass Missverständnisse entstehen. Diese Missverständnisse, die anfangs als Hindernisse erscheinen mögen, spielen jedoch eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen Fortschritt. Sie zwingen uns, Annahmen zu hinterfragen, alternative Perspektiven zu entwickeln und weiterzuforschen. Die menschliche Verständigung, auch in der Wissenschaft, ist nie vollkommen sicher oder unzweideutig. Selbst die besten Modelle und Theorien bleiben immer durch die Grenzen unserer Sprache und Wahrnehmung eingeschränkt. Wir können uns der „Wahrheit“ der Welt nur annähern, doch die Unvollständigkeit und die Grenzen unserer Ausdrucksmöglichkeiten zeigen, dass eine wirklich exakte, objektive Wissenschaft trotz allem unerreichbar bleibt.